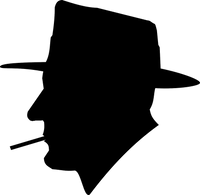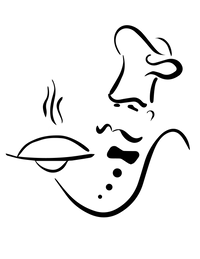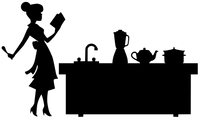Ein Drehbuch für das Kopfkino
Als ich das Büro abschloss, war es spät genug um zu sagen, es sei früh. Ich hatte den Schlusspunkt gesetzt, eine lange Geschichte endlich zu Ende gebracht. Ob es ein gutes Ende war, wusste ich in dieser Nacht noch nicht. Im Licht des neuen Tages würde ich hoffentlich klarer sehen, würde ich vielleicht noch ein paar lose Enden der Geschichte verbinden können, und ich würde ganz sicher neue Kaffee-Ringe auf meinem Schreibtisch finden. Der ruppige Schwarze half, aber man zahlte immer seinen Preis. So wie die Dinge standen, musste ich auf die Trendfarbe Kaffeekringel auf Kiefernholz hoffen, denn der Untersetzer-Zug war lange abgefahren.
Ich hatte Mühe, den Schlüssel ins Schloss zu fummeln mit meinen halb schmerzenden, halb tauben Fingern, mit denen ich die Tasten bearbeitet hatte. Sie hatten sich gewehrt, das tun sie anfangs immer. Aber letzten Endes gaben sie alle nach, jede einzelne. Sobald die ersten Sätze raus waren, wollten die kleinen schwarz-weißen Mistkerle gar nicht mehr aufhören: Sie sangen wie die Kanarienvögel, das tun sie am Ende immer. So kam die ganze Geschichte raus, Zeile für Zeile. Eine Reportage? Mein alter Chef kannte eine Menge anderer Worte dafür und keines davon gefiel mir.
Aber beginnen wir mit dem Anfang.
Eine typische Reportage hat einen szenischen Einstieg, der beim Leser das Kopfkino anschmeißt. Dabei hofft man als Schreiber entweder, dass zum Beispiel ein sehr frei nach Raymond Chandler zitierter Beginn die Vorstellung eines Typen von bogartscher Melancholie an den Tasten erzeugt. Oder man geht auf Nummer sicher und beschreibt Wetter, Landschaft, Stadtszenerie oder etwas ähnlich Geläufiges, von dem sich möglichst alle Leser ein Bild machen können.
Das Dilemma dabei: Je beliebiger der Einstieg, desto größer das Risiko, dass er den Leser nicht wirklich packt. Und je spezieller der Einstieg, desto größer das Risiko, dass der Leser nichts damit anfangen kann.
Also: originell, aber nicht zu originell.
Doch damit nicht genug, es gibt noch ein zweites Problem beim Einstieg: Eigentlich kann eine Reportage nicht für sich alleine stehen. Sie braucht eine Nachricht oder zumindest einen Anlass. Ohne die Nachricht über Wohnraummangel und Mietpreisexplosion sind Menschen, die als Akteure in Reportagen steigende Mieten beklagen, einfach irgendwelche Leute, die über Trivialitäten des Alltags lamentieren (es wird ja immer alles teurer). Und ohne Weihnachten ist ein Schwadronieren über Tannenbäume, Schnee und Kerzenschein nichts weiter als langweilige Lyrik.
Also: Überlegen Sie sich für Ihre Geschichte einen guten Anlass, der sich in wenigen Worten im Teaser-Text darstellen lässt. Manchmal reicht zur Not: Alle erzählen immer davon, jetzt wollte ich’s mir endlich selbst anschauen.
Wenn diese ersten beiden Hürden überwunden sind, fluppt der Rest wie ein Zäpfchen. Je nach persönlichem Temperament, sprachlichen Möglichkeiten und Vorlieben schildern Sie so lebendig wie möglich, was Sie selbst beobachtet oder miterlebt haben. Am deutlichsten wird diese Darstellungsform in der Live-Reportage im Radio: Der Reporter sagt, was er sieht und was er sonst noch von der Sache weiß. Für die Print- oder Blog-Reportage vermittelt der Reporter seine Eindrücke und sein Wissen schriftlich.
Ob mündlich oder schriftlich: Bleiben Sie beim Thema.
Im Beispiel-Text unten geht es um den Dresdner Stollen, der überraschend viel Stoff für eine Geschichte liefert – dennoch ist die Versuchung groß abzuschweifen. Zu den Elb-Brücken und dazu, was die Taxifahrer darüber denken zum Beispiel. Oder zur Frauenkirche und den unfassbar langen Besucher-Schlangen vor dem Eingang. Die Leser sind in den Text eingestiegen, weil sie sich für Stollen interessieren, und sie steigen wieder aus, sobald sie diesen roten Faden aus den Augen verlieren.
Der Mensch im Mittelpunkt
Besser noch als ein Gebäckstück eignet sich ein Mensch, eine handelnde und erzählende Person als roter Faden. Also zum Beispiel ein Bäckermeister, der kompetent Auskunft gibt über den Stollen. Dreht sich die gesamte Reportage ausschließlich um einen Menschen, nennt man diese Textform auch „Porträt“.
Als Tempus für eine live-ähnliche Schilderung bietet sich das Präsens an. Allerdings drängt sich für die Darstellung eines deutlich erkennbar in der Vergangenheit liegenden Erlebnisses oft das Präteritum auf – auch das funktioniert sehr gut.
Was jedoch gar nicht geht: Perfekt. Denn wer seine Sätze mit Hilfsverben gebaut hat, der hat einen eher langatmig-langweiligen und schwer lesbaren Text geschrieben.
Im Gegensatz zum Bericht zitiert die Reportage zusätzlich zu offiziellen Auskunftsgebern auch „einfache“ Leute – also Feriengäste, die etwas darüber sagen, wie gut ihnen der Urlaub gefällt, welches ihre Lieblings-Wellness-Anwendung ist oder warum sie lieber wandern als am Strand zu liegen.
Das Allgemeine im Besonderen zeigen
Ideal ist es, wenn eine Reportage im Konkreten das Allgemeine sichtbar macht. Am Anfang und im Mittelpunkt einer Reportage könnte also zum Beispiel eine Burgruine stehen. Durch die Beschreibung ihrer besonderen Lage auf einem bewaldeten Kamm lassen sich der umgebende Naturraum und dann die gesamte Region charakterisieren. Oder man beschreibt einen einzelnen Schmetterling, dessen Eigenarten und Vorlieben für bestimmte Pflanzen und stellt an diesem Beispiel den gesamten Artenreichtum der Region dar. In der Lyrik nennt sich dieses Stilmittel „pars pro toto“: Teil, das für das Ganze steht. Der entscheidende Vorteil: Ein Teil, ein kleiner Ausschnitt ist anschaulicher, greifbarer und lebendiger als das abstrakt dargestellte große Ganze.
Anders als in objektiven Meldungen und Berichten tritt vielfach die Person des Autors in Erscheinung – mit subjektiven Beobachtungen und Einschätzungen. Die Reportage ist eine interpretierende, meist unterhaltsame und erzählende Darstellungsform.
Deswegen braucht sie auch ein Ende, das in aller Regel nicht so schwer zu finden ist, wie der Anfang. Eine kleine Anekdote oder Pointe, eine winzige überraschende Wendung entlassen den Leser schmunzelnd aus dem Text.
Die Reportage eignet sich also im Corporate Blog sehr gut dafür, Emotionen anzusprechen, Gefühle auszulösen und im besten Falle Bedürfnisse zu wecken. Aber urteilen Sie selbst.
Zuvor jedoch der kurze, aber wichtige Hinweis: Der folgende Text ist historisch. Er ist mehr als zehn Jahre alt und weder aktualisiert noch geprüft. Er dient lediglich als Stil- und Gattungs-Beispiel und nicht der aktuellen Information!
Vom Fastengebäck zum süßen Souvenir
Der Christstollen ist das kalorienreiche Wahrzeichen Dresdens
Mit dem Fastengebäck von Einst hat der Stollen von heute nur noch das Mehl, die Hefe und den Namen gemeinsam. Ansonsten hat sich der Christstollen im Laufe von 600 Jahren gründlich geändert. Zu dem, was er heute ist, machten ihn Dresdner Bäcker wie Thomas Scheinert. Der 34-jährige Bäckermeister hat seine Backstube im Stadtteil Weißer Hirsch. Und wie die meisten seiner Dresdner Kollegen lebt er nicht vom Brot allein: Seit Anfang Oktober backt er Stollen.
Schwarze, stille Nacht, weißer Raureif auf den menschenleeren Straßen, aber in Scheinerts Backstube brennt schon Licht, der Ofen glüht. Nach der klaren Frostluft draußen fühlt es sich drinnen an wie in der Sauna – allerdings mit einem ganz besonderen Aufguss. Es riecht ein bisschen nach Rum und Sternanis, nach Kardamom und Zimt, nach Bittermandel und Zitrone, vor allem jedoch: nach guter Butter, mit der es eine ganz besondere Bewandtnis hat. Sie ist die Seele des „Dresdner Stollens“.
Fruchtig, würzig, süß
Über dessen Laib wacht der Schutzverband Dresdner Stollen e.V. Dem Verein gehören 150 Bäcker an – und nur sie und niemand sonst dürfen die beim Patentamt eingetragene geographische Herkunftsbezeichnung „Dresdner Stollen“ benutzen. Das sei nur logisch, findet Scheinert, einer der Hundertfünfzig: „Ich käme ja auch nicht auf die Idee, hier in Dresden Nürnberger Lebkuchen zu backen.“ Ziele des Vereins sind Traditionspflege, ein gemeinsames Marketing und vor allem die Qualitätssicherung.
Zudem regelt der Verband, was ein Stollen zu enthalten hat: Der Dresdner ist eher fruchtig mit Sultaninen, Orangeat und Zitronat. „Trotzdem gibt es keine zwei Bäcker, die genau den gleichen Stollen backen“, sagt Meister Scheinert. Den Unterschied mache die Gewürzmischung, die präzise abgewogenen paar Gramm auf 150 Kilo Teig, die in seine Rührschüssel passen. Da dürfe man nichts dem Zufall überlassen: „Nur ein kleines bisschen zu viel, und der ganze Teig ist verdorben.“
Der Stollen ist ein Herdentier
Die Zutaten dieser kleinen Prise sind das bestgehütete Geheimnis eines jeden Bäckers. Andere Kniffe verrät er gerne, wohl wissend, dass sie seinen schärfsten Konkurrenten – den Hobby-Bäckern daheim – nichts nützen, denn: „Mein Altmeister sagte immer, der Stollen ist ein Herdentier. Aus einem alleine wird nichts, hundert werden gut.“ Warum das so ist? Genau wie bei der Erbsensuppe, die auch aus großen Gulaschkanonen am besten schmeckt: Man weiß es nicht.
Jedenfalls schleppen Dresden-Besucher das süße Souvenir in Massen aus Sachsens Hauptstadt. Man bekommt den Stollen nach der Bäckerei-Besichtigung, auf dem Strietzelmarkt, Deutschlands ältestem Weihnachtsmarkt oder spät abends in Restaurants rund um die Frauenkirche, falls man tagsüber vergessen hat, ihn zu besorgen. Und zur Not erhält man auch früh morgens bei der Abreise noch einen an der Hotelrezeption.
So viel Butter, wie möglich - und dann noch ein bisschen mehr
Natürlich kann man den Stollen auch im Versandhandel bestellen oder ganz einfach in fast jedem Supermarkt kaufen. Aber das wäre nicht dasselbe. Wer ihn selbst nach Hause schleppt, den meist vier Pfund schweren, duftenden Brocken, und wer ihn dann mindestens zwei Wochen reifen lässt, der weiß, wie gut die Vorfreude zusätzlich würzt. Zudem brauchen Gewürze und Früchte Zeit, um ihr Aroma zu entfalten.
Trocken wird der Stollen dabei genauso wenig wie ein Viertelpfundstück Butter, und dieser Vergleich ist nicht aus der Luft gegriffen: „Mit dem Fettanteil geht man beim Stollen bis an die Grenze des Möglichen“, plaudert Thomas Scheinert weiter aus der Backstube. Ein bisschen Butter oder Schmalz zu viel – und die Hefe stirbt, bevor der Teig aufgegangen ist.
Weil jedoch immer noch ein bisschen mehr geht, wird das noch heiße Gebäck satt mit warmer Butter bestrichen, so dass sie tief in den Laib eindringen kann. Oben drauf kommt dann noch fingerdick Puderzucker – und fertig ist das Backwerk, das ursprünglich mal ein Fastengebäck war. Denn noch bis 1917 waren die Adventswochen für katholische Christen eine „geschlossene Zeit“, eine Phase des Verzichts und der Enthaltsamkeit. Von dieser strengen Regel gab es freilich Ausnahmen, zum Beispiel in Dresden: Mit dem „Butterbrief“ erlaubte Papst Nikolaus V. gegen Ende des 15. Jahrhunderts die Verwendung von Fett zum Stollenbacken – gegen ein kleines „Bußgeld“.
Kandierte grüne Tomaten
Mit den Jahren wuchs die Zutatenliste für den Stollen immer weiter um all das, was der Markt an Gutem und Gehaltvollem hergab. Erst gab's nur den teuren Rohrzucker aus Übersee, dann konnte man im 19. Jahrhundert billigeren Zucker aus Rüben gewinnen und der Stollen wurde süßer. Gewürze und Früchte aus fernen Ländern wurden genauso verbacken wie Rum oder Mandeln. Zu DDR-Zeiten kamen noch Tomaten auf die Zutatenliste. Glauben Sie nicht? „Doch, kandidierte grüne Tomaten schmecken fast genauso wie Orangeat, das wir ja teuer importieren mussten“, bestätigten mehrere Bäcker. Die grünen Tomaten verschwanden nach der Wende wieder aus der Weihnachtsbäckerei.
Was jedoch blieb, und was sich nun sogar wieder wachsender Beliebtheit erfreut, ist das „Abbacken“: Kunden bringen die Zutaten, und gegen ein kleines Entgelt verarbeitet der Bäcker diese mit beim großen Stollenbacken. Der Grund dafür zu DDR-Zeiten: In weihnachtlichen Westpaketen kamen die begehrten Zutaten wie Orangeat oder Mandeln. Praktisch im Tausch wurde ein Teil dieser Spezereien in Form von Stollen wieder in den Westen geschickt. Ein bisschen Nostalgie spielt heute eine Rolle und der Wunsch nach einem ganz individuellen Stollen, der aber schmeckt wie aus der großen Teigschüssel - Sie wissen schon: das Herdentier...
Was fehlt noch an der Stollengeschichte - der Tipp, wo's den besten gibt? Fragen Sie zwei Dresdener, und sie bekommen drei Meinungen. Viele schwören auf ihren kleinen Bäcker nebenan, der seinen in Dresden gebackenen Stollen oft gar nicht „Dresdner Christstollen“ nennen darf. Etwa die Hälfte der Bäcker in Sachsens Hauptstadt spart sich nämlich die Mitgliedsbeiträge für den Stollenverband. Und verzichtet aufs Gütesiegel, das er für die Stammkunden nicht braucht. Vielleicht halten Sie es auch wie die alte Dame aus dem Rheinland, die auf dem Strietzelmarkt ein Scheibchen kostet: „Der Dresdener Stollen ist gut, der schmeckt so wie unserer.“